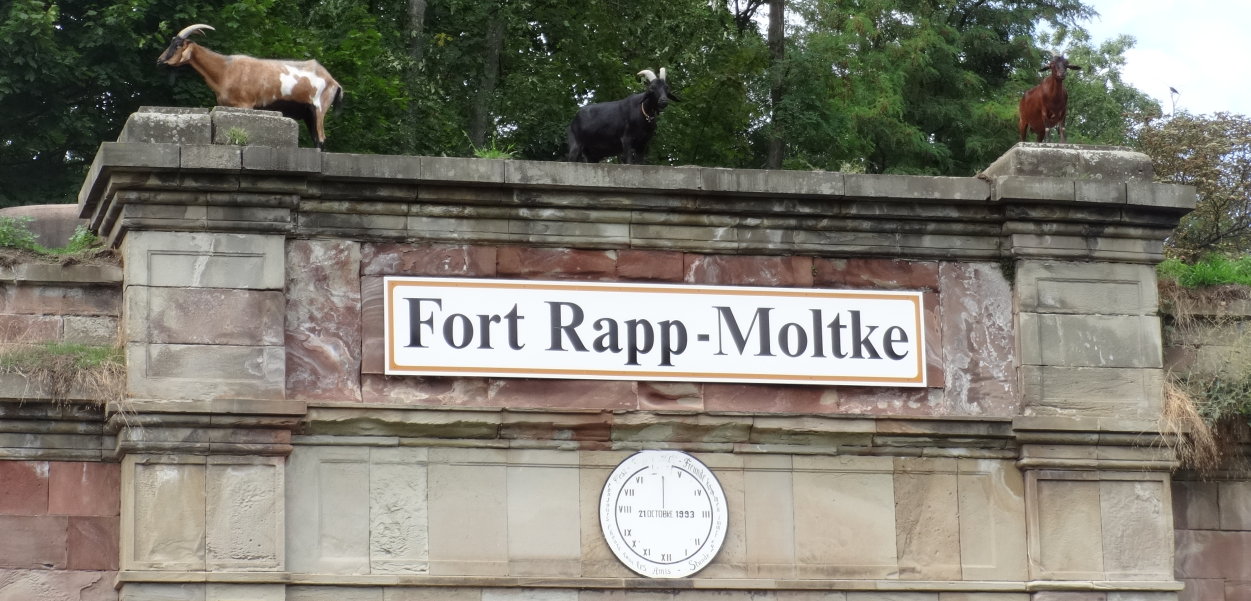Zu meinem 40. Geburtstag wurde ich in einen dieser großen Freizeitparks in Norddeutschland eingeladen. Die Kinder waren noch zu klein, um alle Attraktionen ausprobieren zu dürfen. Die Bahnen jedoch, die sie ausprobierten, brachten mich in die Nähe einer Situation, die bei Krankenkasse und Rentenversicherung beliebt ist: Herzinfarkt mit Todesfolge.
Traumatische Erinnerungen an eine scheinbar harmlose Einbaumfahrt schwirrten auch nach elf Jahren durch die Köpfe der Eltern. Die kleine Tochter saß damals angeschnallt vorne. Papa und anschließend Mama saßen unbefestigt hinten. Alles sehr gemütlich. Dann eine Almhütte mit Foto und dann - freier Fall mit Blick auf eine immer näher kommende aufgewühlte Wasserfläche. Aaaaaah. Mama und Papa hatten überlebt. Die Tochter freute sich, hatte aber keinen dritten Erwachsenen mehr für eine weitere Runde.
 |
| Europapark - Eingangsbereich mit Silver Star im Hintergrund (C) Foto: Adrian Baumann |
Elf Jahre später: Elsass, 2 Omas, 2 Teenager und 2 eingetragene Fahrer für das Mietauto. Meine Frau war froh, dass sie den Tag mit den Omas verbringen konnte, während ich mich der Herausforderung
Europapark stellte. Ich wusste, dass die Kinder mit jeder Achterbahn fahren wollen, je gefährlicher umso besser. Ich fungierte als erwachsene Begleitperson.
Der Europapark in Rust ist für motorisierte Touristen ausgelegt. Deshalb wurden wir vor dem Parkplatz abgesetzt und die Omas samt meiner Frau entschwanden schnell unseren Blicken. Über uns rauschten die Gondeln des Silver Star, der größten Achterbahn des Europaparks. Wutsch, Ratter, Ratter, Wutsch, die nächste Gondel. Nach fünf Minuten hatten wir den Haupteingang erreicht. Tickets für Personen ab 12 Jahren kosten derzeit 47 Euro. Kinder zwischen 4 und 11 oder Senioren ab 60 zahlen 40,50 Euro.
Wir begannen mit einer soften Bootsfahrt. Das Schiff drehte sich mittig und wurde dabei seitwärts geschaukelt. Ganz nett für den Anfang.
 |
| Europapark - Arthur verlässt die Höhle (C) Foto: Adrian Baumann |
Dann ging es auch schon zur ersten der 15 Achterbahnen mit dem Namen
Arthur. Artur bestand aus hängenden Gondeln mit vier sportlichen Sitzen nebeneinander, eingefasst in eine reptile Schale. Die Gondel wurde durch eine unterirdische Phantasiewelt mit vielen Zwergen oder sowas bewegt, schoss dann in die freie Natur hinaus und kam relativ bald wieder am Ausgangspunkt an. Gewartet hatten wir über eine halbe Stunde. Den wirklichen Achterbahn-Kick bekamen hier wohl nur Kinder aus dem 40,50-Euro-Segment.
Darauf stellten wir uns bei Gazprom an. Die Tafel zeigte eine voraussichtliche Wartezeit von 15 Minuten. Gazprom hat den
blue fire Megacoaster gepowert. Alles sehr modern, blau, weiß, technisch. Nach den präzise avisierten 15 Minuten bestiegen wir eine Gondel mit mehreren Sitzreihen und fuhren sehr langsam durch eine Art Werkhalle. Es dampfte und ein Ingenieur mit wirrem Haar hantierte mit einem Schraubendreher am Elektrokasten. Dass das nicht gut geht, konnte man sich ausrechnen. Nicht jedoch, was tatsächlich folgen werde: Puff - schneller als ein Tesla beschleunigte der Wagen und drückte die kreischenden Insassen ins Freie. Vor uns eine blaue Schiene. Überschlag, Drehung horizontal und vertikal, Antäuschen von Entschleunigung und Beschleunigung in luftige Höhen und Seitwärtsneigungen, Foto, Kreischen, Zielpunkt.
Taumelnd verließen wir die Gondel und schwankten auf den Weg zurück. Meine Frau hatte gerade das Foto einer Kirche in Colmar an den Familien-Chat gesendet. Ich schrieb ihr, dass wir erst einmal die Gravitation ordnen müssten. Der
blue fire Megacoaster wurde von uns zum Favoriten des Parks deklariert. Meine Tochter verweigerte die nächste Achterbahn. Alles aus Holz und 40 Minuten Wartezeit.
 |
| Europapark - Holzachterbahn |
Die
grottige Wartezeit wurde durch einen Imbissstand und die Illusion eines schnellen Vorankommens versüßt. Unterhalb des Holzgebildes wand sich die Schlange durch eine auf Germanisch getrimmte Grotte. Die vor uns Anstehenden hätte man durch ein Gitterfenster greifen können. Doch sahen wir nicht, dass sie schon eine halbe Stunde Vorsprung hatten. Sehr clever gemacht: Wege konnten mit Bändern, Toren und Wänden verkürzt oder verlängert werden. Das Ansteh-System vor dem WC eines Broadway-Theaters dient vielleicht als Vorlage, ist aber in der Durchführung weit von den ausgeklügelten Wartebereichen im Europapark entfernt.
Nach 40 Minuten waren wir am
Bahnsteig angekommen und ratterten mit der Gondel nach oben. Schon allein das markante Geräusch und die Fahrtrichtung - nach oben - ließen das Blut in den Adern erstarren. Fast so wie beim Hausarzt, wenn er bei eingestochener Nadel fragt, wo denn nun schon wieder die Ader sei und ob ich ihm heute kein Blut geben wolle.
Stichwort Hausarzt: Die Holzachterbahn ist wohl nur bedingt für Personen ab 50 geeignet. Bei einer der letzten Abfahrten holperte der Wagen so akzentuiert über die Schienen, dass ich jeden einzelnen Rückenwirbel spürte. Es gibt auch Bahnen, wo die Seitwärtsbewegung so ruckartig erfolgt, dass ein betagter Hals kurz vor dem Schleudertrauma steht. Best Ager und Senioren sollten sich daher Geschwindigkeit, Strecke und Bauart der Gondeln ansehen. Gondeln mit Kopfstützen eignen sich am besten, da sie wegen der fixierten Körperhaltung auch gewagte Loopings und Schräglagen ohne Bandscheibenvorfall oder Schleudertrauma überstehen lassen.
 |
| Europapark - Silver Star (C) Foto: Adrian Baumann |
In solch einer stabilen Sitzposition konnte auch der
Silver Star powered by Mercedes absolviert werden. Auch bei
Pegasus waren die Gondeln hervorragend auf die Mitfahrer abgestimmt. Einen besonders langen Fahrspaß bot
Poseidon. Die Achterbahn war mit einer Wasserattraktion kombiniert. Nachdem die Leute einmal durchnässt worden waren, gab es eine zweite Achterbahntour und dann noch eine weitere ausgiebige Dusche.
Nach acht Stunden hatten wir fast alle 15 Achterbahnen ausprobiert und sprachen immer noch von der blauen
Gazprom. Eine Werbewirkung, die ein ehemaliger Bundeskanzler wohlwollend zur Kenntnis nehmen würde. Aber auch der Name
Europapark ist schlau gewählt. Trafen wir doch jede Menge Franzosen im Park. Europa verbindet eben. Wäre ja auch schade, wenn die Besucher-Klientel aus dem Elsass fern bleibt, nur weil der Park
Schwarzwald,
Heide oder
Fantasia heißt.
Europapark war wohl genau die richtige Entscheidung.
 |
| Europapark - Themenwelt Russland mit gemütlicher Auffahrt innerhalb eines Turms und Abfahrt mit rotierender Gondel |
Da die Omas und meine Frau uns pünktlich abholen wollten, eilten wir vorbei an den seniorengerechten Wasserbecken mit langsamen Schiffen, dem gemächlich bewegten Aussichtsturm, an Märchenwäldern und Themenwelten, Schießbuden und Eisständen, Wasser-Shows und dem per Laserstrahl geschützten Schatz der Queen.
Ein Tag an der Grenze zum Elsass neigte sich dem Ende zu. Das Tagesziel war für Omas, Eltern und Kinder erreicht. Beim eventuellen Aufsatz über das schönste Ferienerlebnis stehen der Europapark und Gazprom an erster Stelle.
Autor: Matthias Baumann